JOHANN-SEBASTIAN BACH LES QUATRE OUVERTURES
Jordi Savall, Le Concert des Nations
Alia Vox Heritage
17,99€
Ausverkauft
Referència: AVSA9890A+B
- LE CONCERT DES NATIONS
- Dirección: JORDI SAVALL
- Fabio Biondi violon concertant
- Alfredo Bernardini & Paolo Grazzi hautbois
- Josep Borràs basson
- Marc Hantaï flûte solo
Noch heute verbinden viele ihre Vorstellung von Bach mit jener Darstellung, wie sie durch den offiziellen Portraitmaler der Stadt Leipzig überliefert ist: ein wohlgenährter, alter Mann mit leicht gerötetem Gesicht und groben Zügen, in weißer Perücke und dem schwarzen Rock des Kantors. Griesgrämig, fruchtbar und vor allem streng lutherisch sieht man ihn mit kraftvollem Gang die dreißig Schritte zwischen seiner Wohnung in der Thomasschule und dem gotischen Portal der Kirche zurücklegen, wo er Sonntag für Sonntag, Jahr um Jahr Kantaten, Motetten und Orgelstücke zur Aufführung bringt, die dieser „Gottesdienst-Beamte“ seinen „hochedlen, hochweisen und hochehrenwerten Herren“ schuldet – und zu Gottes höchster Ehre. Sicher wird durch den Umfang seines geistlichen Werks sowohl an Quantität wie an Qualität und mehr noch durch das völlig geistlich geprägte Milieu, in dem sich sein Genie entfaltet, dieses Bild des religiösen Musikers verstärkt. Doch Bach auf diesen wenn auch sehr umfangreichen Bereich einzuschränken, hieße eine wesentlich vielschichtigere Persönlichkeit herabzusetzen, ja sogar die richtige Sichtweise dieses kirchlichen Werks einzuengen. Denn trotz der Wirklichkeitsferne, trotz seiner fiebrigen Neigung zur Kombinatorik bleibt Bach ein Wesen aus Fleisch und Blut, von dem die allzu seltenen Zeitzeugen sagen, er sei gesellig und lebensfroh, reiselustig und gern in Gesellschaft seiner Freunde, der genüsslich seine Pfeife rauchte oder ein Glas Schnaps trank.
Die Werke für Cembalo oder Soloinstrumente oder die Kammermusik verweisen zwar auf den „profanen“ Aspekt seines Schaffens, abseits von der Kontrolle durch seine kirchlichen Vorgesetzten; aber sie verweisen auf den Privatmenschen im kleinen häuslichen Kreis der Familie und der Freunde, der Schüler und Kollegen. Nun lebte aber Bach auch in seinem Jahrhundert, er ist auch ein öffentlicher Mensch, der seinen Zuhörern genenübertritt und Beifall von ihnen fordert: der Mann der weltlichen Kantaten, die allegorische Huldigungen oder richtige Miniopern sind, der Konzerte – und der Suiten. Das alles gehört zu der meist vernachlässigten Palette seiner Tätigkeit: als Organisator von Konzerten musste er Musiker und Solisten anstellen, sie bezahlen, ihnen aber auch die von ihm selbst ausgesuchten Instrumente zu Verfügung stellen, die Partituren besorgen, die Proben und Aufführungen festlegen, wobei er selbst dirigierte und dabei das Cembalo, die Geige oder Bratsche, die Gambe oder das Cello spielte.
Im winzigen Fürstentum Anhalt-Köthen obliegt ihm von 1717 bis 1723 die Leitung eines Orchesters, einer „Kapelle“, die von Größe und Talent gesehen manch einem berühmteren Hoforchester überlegen war; er spielt mit dem Gambisten Abel oder dem Cellisten Linigke, besucht den Geiger Pisendei; er kauft ein Cembalo von Mietke und erwirbt Geigen von Stainer. Nach seiner Amtsübernahme in Leipzig und nachdem er fünf Jahre darauf verwendet hatte, die Grundlage für ein Repertoire zu Sankt Thomas zu schaffen, sehen wir ihn eifrig beschäftigt im Amt des Director Musices, als städtischer Musikdirektor, der ein Collegium Musicum übernimmt, eines der beiden Orchester Leipzigs, genau jenes, das zu Beginn des Jahrhunderts der ganz junge Telemann gegründet hatte.
Dieses Collegium Musicum ist einen näheren Blick wert, wurden doch dafür einige, wenn nicht sogar alle Suiten geschrieben und dort sicher mehrmals aufgeführt. Mizler lässt uns 1736 wissen, dass „die Musiker, die an diesen Konzerten beteiligt sind, meistens Studenten der Stadt sind und alle sehr gut spielen, so gut sogar, dass bekanntlich nach und nach berühmte Künstler aus ihren Reihen hervorgegangen sind. Jeder Musiker kann öffentlich bei diesen Konzerten auftreten, und es gibt viele Zuhörer, die den Wert eines begabten Musikers zu schätzen wissen.“
Im Frühjahr 1729 übernimmt Bach also die Leitung dieses Collegium Musicum, das jeden Freitagabend von acht bis zehn Uhr in den verrauchten Räumen des Cafe Zimmermann spielt, das in der Catherstraße, der Hauptstraße Leipzigs, liegt. Während der jährlichen Messezeit, im Juni und September, finden die Konzerte zweimal wöchentlich statt, dienstags und freitags. Und im Sommer stellt der gute Zimmermann Tische und Bänke in den Gärten vor den Stadtmauern im Schatten der Linden am Grimmaer Tor auf. Er selbst zahlt direkt Bachs Lohn aus, und der Dirigent muss für alles sorgen, die praktische Organisation, Gagen, Programme – im Gegenzug versteht es der Kaffeehausbesitzer, ein Publikum anzulocken, das von der Qualität und der Vielfalt der Musik, an der es sich erfreut, angezogen wird. Konzerte, Suiten, verschiedene musikalische Divertimenti von Bach selbst oder anderen (meist italienischen) Komponisten: unter diesen Bedingungen wird ein sehr bedeutendes Repertoire gespielt, zu dem sich noch Bachs Instrumentalwerke gesellen. Dieser sollte so acht Jahre lang die „musikalische Saison“ in Leipzig leiten – bis zum Sommer 1737 – was ungefähr 450 Konzerten entspricht… Aus unbekannten Gründen gibt er dann diese Tätigkeit auf, nimmt sie ab Oktober 1739 für einige Jahre wieder auf, wodurch sie die Anzahl dieser Konzerte wieder auf mindestens 600 erhöht! Es ist nicht bekannt, bis wann er diese erdrückende Aufgabe erfüllte; jedenfalls trug sie ihm zweifellos wie auch seinem Orchester große Bekanntheit ein: 1741 beschließt eine Gruppe bürgerlicher Familien, die regelmäßige Arbeit des Collegium Musicum zu finanzieren, das damit zu einer nicht kommerziellen künstlerischen Einrichtung wird. Das Orchester richtet sich in einem der Messegebäude, dem Gewandhaus ein. Vierzig Jahre später wird das Orchester von der Stadt übernommen: So entstand das berühmte Gewandhaus-Orchester, und der Gedanke ist bewegend, dass es Telemann und Bach als Paten hatte.
Von den vier heute bekannten Suiten Bachs wurde kein autographisches Manuskript gefunden. Alles deutet darauf hin, dass der Musiker vielleicht zahlreiche andere geschrieben haben könnte – eine fünfte, im Bachwerkverzeichnis aufgeführte (BWV 1070) ist zweifellos von seinem ältesten Sohn Wilhelm Friedemann. Aber davon kennt man verschiedene frühere Abschriften sowie die einzelnen Partituren für Instrumente. Es lässt sich aber feststellen, dass anders als die sechs Konzerte mit mehreren Instrumenten – die „Brandenburgischen Konzerte“ – diese kein zusammenhängendes Ganzes, einen vom Autor so gewollten Zyklus oder eine Sammlung darstellen. Sie wurden einzeln für den jeweiligen Anlass komponiert und entstanden innerhalb von etwa sechs Jahren für unterschiedliche Zwecke, ohne dass man sie genau datieren könnte: Ende der Köthener Jahre, Anfang der Leipziger Jahre, mit späteren Wiederaufnahmen (heute gibt es darüber widersprüchliche Vermutungen).
Der Begriff der Suite selbst, wie er heute nicht unbegründet meist verwendet wird, war im 18. Jahrhundert nicht üblich, als man von Ouverture sprach. Die eigentliche Ouvertüre war die breit angelegte Einleitung für eine Reihe kürzerer Stücke, die zu einer Tanzfolge angeordnet waren, und das Ganze benannte man nach der rhetorischen Formel des Pars pro toto nach dem ersten Stück. In seinem Musicalischen Lexikon von 1732 schreibt Johann Gottfried Walther, dass „die Ouvertüre ihren Namen vom Verb öffnen ableitet, denn dieses Instrumentalstück öffnet gewissermaßen die Tür für die Folgen oder Stücke, die ihm folgen“. Die Zeit war versessen auf diese Zerstreuungen – der Rekord dieser Gattung gehört wieder einmal Telemann, mit etwa zweihundert ihm zugeschriebenen Ouvertüren. Als Musik für Prunkfeste und Galanterien hatte die Ouvertüre oder Suite für die Zeitgenossen vor allem den Vorzug, sie in die Mode von Versailles zu versetzen. Tatsächlich grassierte die Frankomanie: kaum ein Fürstlein, das nicht ein neuer Ludwig XIV. sein wollte, und diese Manie hatte selbst die Kleinbürger erfasst, die die französischen Manieren zuweilen bis zur unfreiwilligen Karikierung nachäfften.
Das Vorbild der dreiteiligen Ouvertüre und der stilisierten Tänze Lullys verbreitete sich schließlich auch jenseits der Grenzen; die Gattung hatte bereits 1670 den Rhein überschritten und sich zur Jahrhundertwende ausgebreitet, sie gewann ungeheure Beliebtheit in den ersten dreißig Jahren des 18. Jahrhunderts. 1740 schreibt der Leipziger Kritiker Johann Adolf Scheibe, der einmal gegen Bach polemisierte, in seinem Critischen Musicus, dass die Ouvertüren nicht mehr „so geschätzt sind wie sie es früher einmal waren“. Für Bach gab es genügend deutsche Vorbilder, und seine Suiten reihen sich in eine Tradition, die einem ausgeprägten Geschmack des Publikums entspricht, wo der glanzvolle Prunk der Ouvertüren mit der gutmütigen Schlichtheit der bekannten Tänze verknüpft wird: Größe und Rhythmus, Fröhlichkeit, gute Manieren und eine Prise Gefühl, alle Zutaten fanden sich dort zusammen, um ein Auditorium zu verführen. Aber die Orchestersuite bot dem Musiker auch die Gelegenheit, einer Kunst zu huldigen, für die er seit seiner Jugend eine lebhafte Bewunderung empfand, die Kunst der Franzosen und vor allem die Lullys. Hatte er nicht vormals am kleinen frankophilen Hof von Celle unter den hugenottischen Emigranten den französischen Kapellmeister Philippe de la Vigne oder den Ballettmeister Thomas de la Selle, einen Schüler von Lully getroffen? Das spiegelt sich genau im Aufbau seiner Suiten wider.
Denn die zahlreichen, damals für Soloinstrumente bestimmten Suiten – bei Bach das Cembalo (Partiten, Englische und Französische Suiten), aber auch die Laute, Geige oder das Cello solo – waren immer nach dem selben Schema aufgebaut: eine Folge von vier abwechselnd langsamen und schnellen Tänzen – Allemande, Courante, Sarabande und Gigue – davor meist eine mehr oder weniger ausgeprägte Einleitung wie z.B. Ouvertüre, Sinfonie oder sonstiges Vorspiel; je nach Fantasie des Komponisten konnten weitere Tänze eingeschoben werden, meist Menuett, Gavotte oder Bourrée. Doch indem Bach in seinen Orchestersuiten die eindeutig französische Version anwendet, grenzt er sich ganz klar von diesem Schema ab und verbannt zunächst systematisch die Allemande aus der Tanzfolge; er verzichtet auf Stereotypie und entfaltet dabei eine Phantasie und Freiheit, die Konventionen nicht beachtet, und verleiht jeder der vier Suiten eine außergewöhnliche Eigenständigkeit.
In den vier Stücken fällt besonders die umfangreiche Bearbeitung des ersten Stücks, der eigentlichen Ouvertüre, ins Auge, die schon allein ein Drittel des gesamten Werks ausmacht (Suite 3 und 4). Sie ist unmittelbar von der französischen Ouvertüre beeinflusst und übernimmt deren dreiteilige Gliederung: zwei majestätische Flügel (im Vierertakt) von schmückendem Charakter und reich an punktierten Rhythmen umrahmen ein rasches, fugiertes Zwischenspiel in konzertantem Stil. In der Suite Nr. 2 ist der zweite, langsame Teil der Ouvertüre nicht eine abgewandelte Wiederholung des ersten, sondern ein völlig neues Zwischenspiel. In der Ouvertüre entfaltet sich die größte instrumentale Pracht: Tutti im Orchester, dichter Stil, der von fünf Stimmen in der Suite Nr. 2 bis zu zwölf Stimmen in der strahlenden Suite Nr. 4 reicht. Im übrigen ist diese Ouvertüre der Suite Nr. 4, wie wir sie heute kennen, nur die dritte Fassung eines verloren gegangenen Originals, die aber 1725 bei der Bearbeitung des Anfangschors der Kantate BWV 110 für den Christtag wieder verwendet wurde.
Die Instrumentalbesetzung variiert sehr von einer Suite zur anderen. Sie ist leicht und transparent in der Suite Nr. 2, der einzigen in Moll, mit ihrer schlicht von den Streichern und dem Continuo begleiteten Flötenstimme, und gleicht eher einem Konzert für Flöte und Streicher – im übrigen wurde diese Suite möglicherweise für den berühmten französischen Flötisten Buffardin geschrieben, der Soloflötist am Hof zu Dresden war und den Bach gut kannte. In der Suite Nr. 1 werden Streicher und Continuo um zwei Oboen und ein Fagott erweitert, wie es der französischen Instrumentation entsprach. In den beiden D-Dur-Suiten Nr. 3 und 4 erscheinen die Trompeten, die in dieser Tonart natürlich klingen. Die Instrumente sind hier auf drei Gruppen verteilt: Trompeten, Oboen und Streicher – in der Suite Nr. 3 drei Trompeten, Pauken, zwei Oboen, Streicher und Continuo, und in der Suite Nr. 4, deren „Orchestrierung“ die reichste von den vieren ist, drei Trompeten, Pauken, drei Oboen und Fagott, Streicher und Continuo. Mit Ausnahme von Suite Nr. 2, der intimsten, sind diese Besetzungen nur selten im Tutti zu hören, da es dem Komponisten Freude macht, die Klangfarben von einem Tanz zum nächsten zu variieren. Schließlich fällt auf, dass die Trompeten, Oboen und das Fagott sich vor allem zur Aufführung im Freien anbieten, ja dies geradezu erforderlich machen, während die Soloflöte in Suite Nr. 2 im Gegenteil eher im Saal oder in der „Kammer“ zur Geltung kommt.
Nach der Ouvertüre à la française bietet die Suite Nr. 1 eine Courante und zwei Gavotten an, wobei in der zweiten die Streicher unisono erklingen, als wollten sie die Wirkung von Fanfaren in Abwesenheit der Trompeten suggerieren. Es folgt eine Forlane, ein aus Friaul stammender und in Frankreich übernommener Tanz, der nur einmal in den vier Suiten vorkommt. Dann zwei Menuette, zwei Bourrées und zwei Passepieds, drei gleichfalls französische Tänze. Die vier Tanzpaare tragen den Hinweis „abwechselnd“, das heißt, dass der erste jeweils nach dem zweiten Tanz wiederholt wird, so wie später der dritte Satz in der klassischen Sinfonie verläuft. Auffallend ist das Wechselspiel zwischen dem Tutti und dem Concertino von den beiden Oboen und dem Fagott, auch wieder im Stil der französischen Suite.
Der Gesamtaufbau der Suite Nr. 2 ist eindeutig der originellste der vier. Auf die Ouvertüre folgen ein Rondo im Rhythmus einer Gavotte, eine Sarabande, zwei Bourrées, die zweite „langsam“ vor der Wiederholung der ersten („abwechselnd“), eine Polonaise mit ihrer Dublette, wo die Flöte das im Bass vernommene Hauptmotiv variiert, ein einzelnes ºMenuett und zum Abschluss eine virtuose und graziöse Badinerie als notwendige Huldigung an Frankreich und seine legendäre Leichtigkeit.
Nach der großartigen Ouvertüre der Suite Nr. 3 erklingt in der sehr berühmten Air, die nur von den Streichern gespielt wird, eine der anmutigsten Melodien, die Bach je komponiert hat, eines der zu Recht beliebtesten Stücke. Darauf folgen zwei Gavottes (mit Wiederholung der ersten), eine Bourrée und eine Gigue.
In der Suite Nr. 4 kann man schließlich beobachten, wie der Komponist den kleinen Chor der vier Holzbläser (drei Oboen und Fagott) abtrennt und den Streichern wie in Mehrchörigkeit gegenüberstellt (rasches Fugato der Ouvertüre, Bourrées, Gavotte). Auf die Ouvertüre folgen tatsächlich zwei Bourrées („abwechselnd“), eine Gavotte, zwei Menuette mit Wiederholung („abwechselnd“) und eine Rejouissance zum Schluss.
GILLES CANTAGREL
Übersetzung: Dorothea Preiss
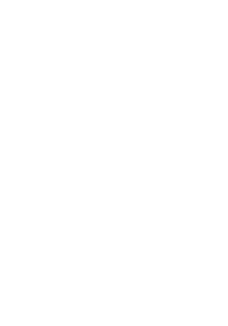
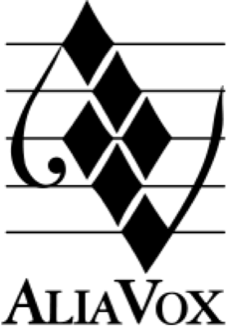





Compartir